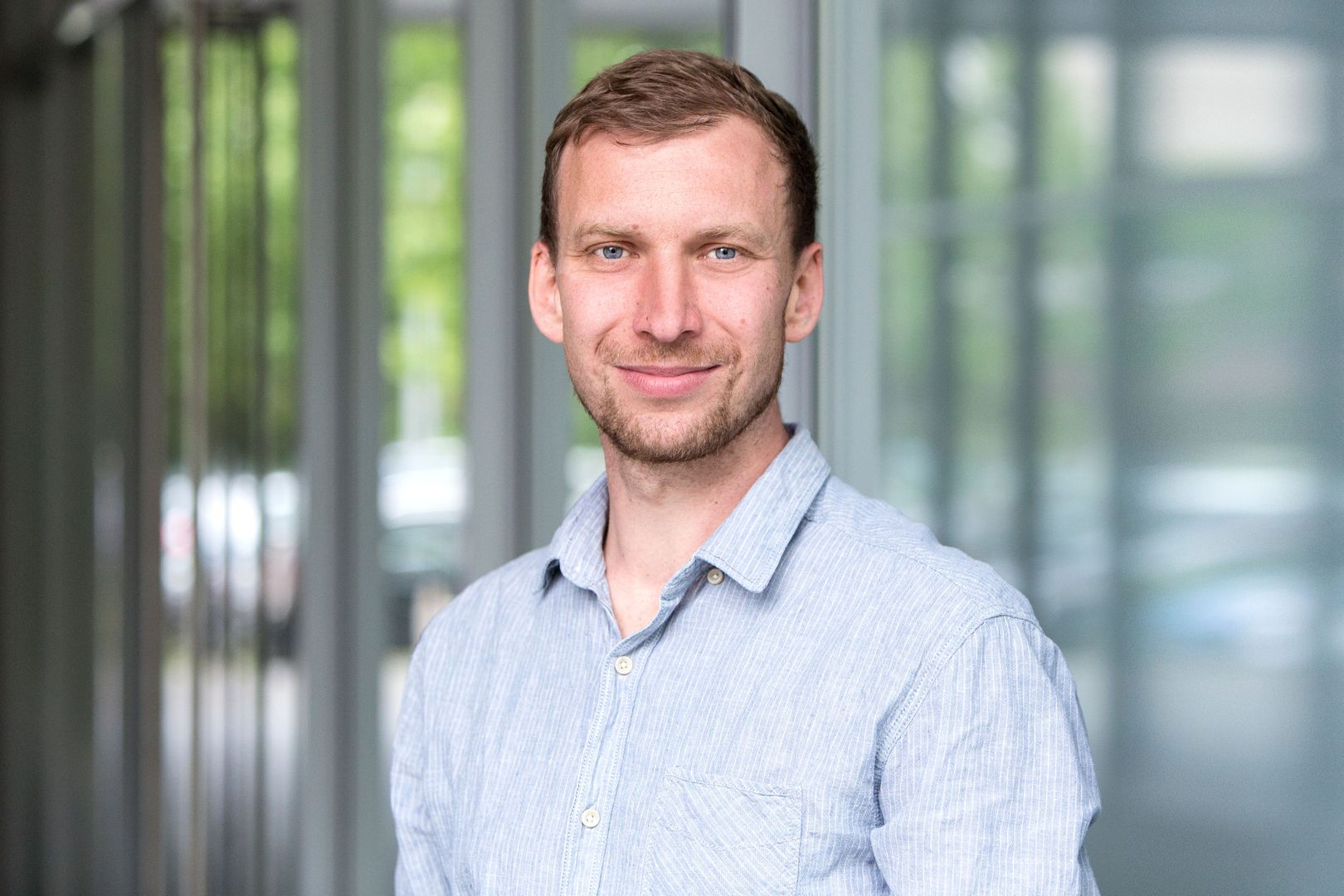Und sie bewegt sich doch
Wie eine zunehmend elastische Stromnachfrage unser Weltbild auf den Kopf stellen wird.

Bisher war doch alles recht einfach, nicht wahr? Der Kraftwerkspark hat Strom produziert, wann auch immer Strom gebraucht wurde. Solange Strom nachgefragt wurde, reihten sich die Kraftwerke eins nach dem anderen ein, die mit den niedrigsten Grenzkosten zuerst, am Ende dann die teureren. Merit Order nennt man das Prinzip, nach dem der Dispatch, also der Kraftwerkseinsatz, von den Betreibern entschieden wurde. Alter Hut. Sogar die Integration der Erneuerbaren Energien, die größtenteils mit Grenzkosten nahe 0 in den Markt dringen, konnte man noch mit dem Merit-Order-Prinzip erklären. Die Erneuerbaren drängten die teureren Kraftwerke schlicht aus dem Markt, der Strompreis an den Börsen sank.
Doch schon heute knarzt das Erklärungsmodell – denn mehr als das ist das Merit-Order-Prinzip eigentlich nicht – an allen Ecken und Enden:
- Da externalisierte Kosten wie etwa CO2-Kosten oder die Kosten für Endlagerung des atomaren Abfalls nahezu unbedeutend in der Bepreisung des Kraftwerkseinsatzes sind, kommt es zu dem Paradox, dass effiziente Gaskraftwerke aus dem Markt gehen, während die dreckigsten Kraftwerke weiter vor sich hin feuern. Die externalisierten Kosten werden auf die gesamte Gesellschaft abgewälzt, anstatt ein Gewicht bei der Abfolge des Kraftwerkseinsatzes zu erhalten. Hinzu kommt, dass die zahlreichen staatlichen Eingriffe, etwa bei der direkten und indirekten Subventionierung von konventionellem und erneuerbarem Strom, im Erklärungsmodell nicht berücksichtigt werden – schließlich dienen diese Subventionen meist dem Zu- oder Rückbau von Kapazitäten, nicht aber dem eigentlichen Betrieb. Trotzdem führt dies dazu, dass die Merit-Order kaum noch Aussagekraft über die tatsächlichen Gesamtkosten des Kraftwerkseinsatzes und damit der produzierten Kilowattstunde besitzt. Das (recht lapidare) Gegenargument hier lautet meist: Ist halt so und war schon immer so…
- Das zweite, streng genommen größere Problem für das Merit-Order-Prinzip ist die Annahme, dass die Kostenstruktur auf Kraftwerksseite immer gleich ist: Die erste produzierte Megawattstunde kostet pro Kraftwerkstyp so viel wie die zweite und die dritte und die vierte und immer so weiter. Das Merit-Order-Modell ist ein statisches Modell, das nur einen bestimmten Zeitpunkt betrachtet, nicht aber eine Abfolge von Zeitpunkten und damit die Dynamik auf Grenzkostenseite. In Zeiten, in denen Grundlast das vorherrschende Thema in der Energiewirtschaft war, konnte man mit diesem statischen Modell auch tatsächlich gut leben. Doch die Realität sieht heute anders aus. Konventionelle Kraftwerke fahren immer seltener 24/7. Überkapazitäten auf konventioneller Seite sowie die Zunahme der volatilen Einspeisung aus Solar und Wind mögen hier als Gründe angerissen werden. Anders gesagt: Die Rampen in der Stromproduktion, das An- und Abfahren von Kraftwerken – auch von Kraftwerken der Erneuerbaren Energien – spielen in der Betrachtung keine Rolle. Eine einfache Analogie: Auf einer 100 km langen Autobahnstrecke verbraucht Ihr Wagen weniger Benzin als auf 100 km im Innenstadtverkehr mit viel Stop & Go. Nun könnte man einwenden, dass sich dieses Problem leicht lösen ließe. Anstatt eine Merit Order „pro Tag“ könne man schließlich auch 96 Merit Orders betrachten (die Energiewirtschaft rechnet in Viertelstunden und ein Tag besteht aus 96 Viertelstunden). Keine Frage, das wäre schon mal besser. Nur: Die Dynamik der Entscheidungen über einen Kraftwerkseinsatz wird man auch dann nur sehr schwer berücksichtigen können. Das Stichwort hier: Interdependenz. Fahre ich über die Schnellstraße in die Stadt, wenn ich weiß, dass dort ein Stau wartet oder bleibe ich dann nicht lieber direkt zu Hause? Schmeiße ich das Kraftwerk an, wenn ich weiß, dass die nächste Windfront schon vor der Tür steht und meine Erlöse in den nächsten Viertelstunden wieder sinken lassen wird? Und die Kosten für das erneute Abfahren müssten bei der Entscheidung für das Anfahren bereits berücksichtigt werden. Diese Dynamik lässt sich über das Merit-Order-Prinzip wahrlich kaum noch darstellen.
Die Flexibilisierung des Stromverbrauchs
Während man sich bei den beiden genannten Problemen noch mit allerlei Trickserei behelfen kann, um das heutige Merit-Order-Prinzip am Leben zu erhalten, ist eine dritte Entwicklung nicht wegdiskutierbar. Das Merit-Order-Prinzip geht von einer inelastischen Nachfrage aus, anders gesagt: Strom wird eben immer dann verbraucht, wenn er gebraucht wird und die Nachfrage nach Strom ist in Stein gemeißelt, unveränderbar. Strom wird ohne Rücksicht auf Preissignale konsumiert. Strom kommt halt aus der Steckdose. Doch diese Annahme ist schon heute nicht mehr zeitgemäß, der Stromverbrauch beginnt bereits sich zu flexibilisieren…
In Zukunft wird daher nicht mehr die letzte nachgefragte Megawattstunden den Preis für alle konsumierten Megawattstunden bestimmen, wie es heute der Fall ist, sondern vielleicht die flexibelste Megawattstunde auf Verbraucherseite. Ein Beispiel: Am 9. Oktober 2024 liegen die Windprognosen falsch, eine erwartete Windfront verspätet sich, sodass für die Viertelstunde zwischen 16:30h und 16:45h die Strompreise auf 800 Euro die Megawattstunde steigen. Im klassischen Merit-Order-Modell werden nun teure Gaskraftwerke aktiviert, da diese sich bei hohen Strompreisen endlich rentieren und auch recht schnell wieder abfahren können, wenn die Windfront eingetroffen ist. Nun passiert aber um 16:30 etwas anderes: Eine ganze Reihe an großen, mittleren und kleineren Stromverbrauchern verzichten darauf, Strom tatsächlich zu verbrauchen. Sie verschieben ihre Last auf 18 Uhr, da die Windfront die Preise wieder sinken lassen wird. Der Strompreis sinkt bereits um 16:45h wieder auf das gewohnte Niveau, ohne dass ein Kraftwerk seine Fahrweise anpassen musste. Diese elastische Stromnachfrage ist im starren Merit-Order-Modell nicht vorgesehen und daher auch nicht durch das Modell erklärbar.
Mehr zum Nachlesen
Wie aber werden Strompreise in Zukunft entstehen – wohlgemerkt nicht nur in Deutschland sondern wohl in den allermeisten Ländern der Welt? Welches Modell könnte Dynamiken besser erklären? Wir haben an dieser Stelle natürlich noch keine feste Vorstellung davon. Wir sind uns aber sicher, dass ein zweidimensionales Modell wie das Merit-Order-Prinzip nicht mehr ausreichen wird, folgende Entwicklungen abzubilden:
- Der Strommarkt der Zukunft wird heliozentrisch um die Produktion von Wind- und Solarstrom herum aufgebaut sein. Die Summe der von Solar- und Windkraft produzierten Strommengen ist der entscheidende Indikator für alles, was im Anschluss im Strommarkt geschieht.
- Steile Rampen in der Stromproduktion von Solar- und Windkraft werden die entscheidenden Preissignale senden.
- Andere Teilnehmer des Strommarkts werden sich dynamisch und in gegenseitiger Abhängigkeit um Solar- und Windkraft herum organisieren, um diese Rampen zu „bedienen“.
- Dies werden nicht mehr nur regelbare Kraftwerke (konventionelle und/oder erneuerbare) oder Speicher sein sondern in erheblichem Ausmaß auch flexible Stromverbraucher, deren Flexibilität somit selbst auch preisbildend wirken wird.
Unsere Dienstleistungen für flexiblen Stromverbrauch
- Regelenergie: Zusatzerlöse am Regelenergiemarkt durch flexiblen Stromverbrauch
- Best of 96:Senken Sie Ihre Energiekosten um bis zu 30 Prozent, in dem Sie Ihren Stromverbrauch an die Preise des Strommarkts anpassen!
- Statische Stromtarife:Auch ohne flexible Verbraucher können Sie aktiv die Energiewende unterstützen, in dem Sie grünen Gewerbestrom beziehen
Fotocredit: Johann Dréo, Lizenz: CC BY-SA 2.0
Weitere Informationen und Dienstleistungen