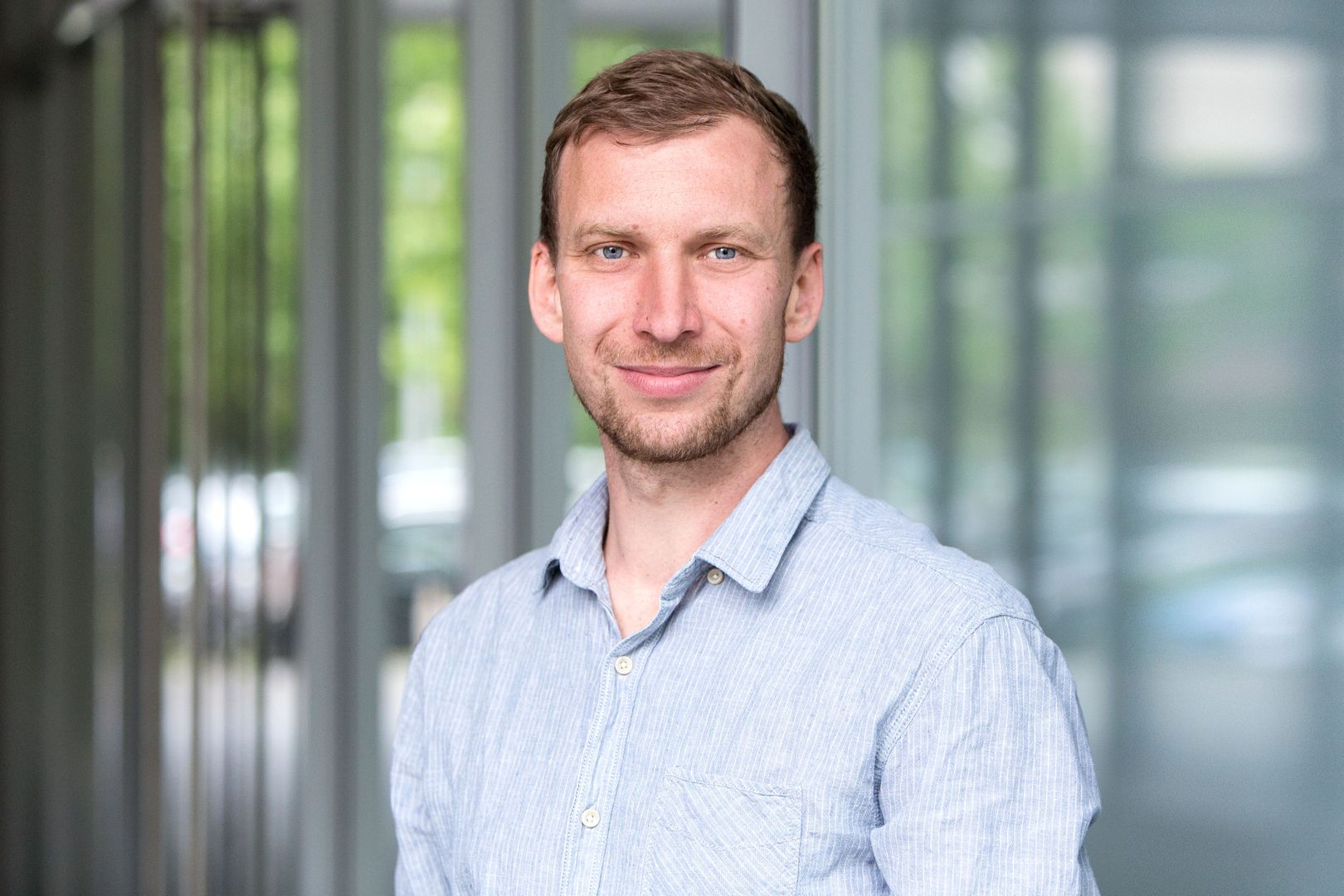Was ist das Geschäftsmodell eines Virtuellen Kraftwerks (VPP)?
Seit einigen Jahren hat sich das Virtuelle Kraftwerk als inzwischen gar nicht mehr so neue Rolle in der Energiewirtschaft etabliert. Heute ist ziemlich klar, was ein Virtuelles Kraftwerk ist und warum es sinnvoll ist, dezentrale Akteure wie Wind, Sonne, Bioenergie, Wasserkraft, Batterien, Elektrolyseure und viele andere zu vernetzen, deren Leistung zu prognostizieren und zu optimieren und die Anlagen zu steuern. Aber wie kann man mit einem Virtuellen Kraftwerk Geld verdienen? Was ist das Geschäftsmodell eines Virtuellen Kraftwerks oder – um ein Synonym zu verwenden – eines Aggregators?
Inhaltsverzeichnis
- Prognose, Handel, Optimierung & Abregelung Erneuerbarer Energien
- Überblick: VPP Business Case “Prognose, Handel, Optimierung & Abregelung Erneuerbarer Energien”
- Aggregation der Netzflexibilität aus Erneuerbaren Energien
- Überblick: VPP Business Case “Aggregation der Netzflexibilität aus Erneuerbaren Energien“
- Demand Response Aggregator
- Überblick: VPP Business Case “Demand Response Aggregator”
- Ein paar Gedanken zum Schluss

Prognose, Handel, Optimierung & Abregelung Erneuerbarer Energien
Da der Anteil der Erneuerbaren Energien auf vielen Energiemärkten der Welt steigt, stellt sich die Frage, wie die Einspeisung eben dieser Ressourcen gesteuert werden kann. Zwar mag der Anteil der erneuerbaren Energien im Netz und somit auch im Portfolio der Stromhändler anfangs gering sein und die Volatilität keine große Herausforderung darstellen, doch scheint es eine gewisse Schwelle zu geben, ab der es für den Portfoliomanager finanzielle Nachteile bringt, die erneuerbare Energieeinspeisung nicht zu prognostizieren und zu steuern.
Am Beispiel eines normalen Stromversorgers: In den 2000ern und frühen 2010er Jahren belief sich die Menge an Solar- und Windkraft auf wenige Megawatt in einem viel größeren Gesamtportfolio. Eine unstete Einspeisung von PV und Wind hatte somit keine großen Auswirkungen auf die Gesamterzeugung des Versorgers – die Schwankungen wurden im Grunde durch die allgemeine Baseload der konventionellen Stromerzeugung gedämpft. Aber sobald dieser Energieversorger seine Erzeugung aus erneuerbaren Energien auf, sagen wir, 20 Prozent seines Portfolios erhöht, haben Sonne und Wind einen größeren Einfluss auf das tägliche Management des Gesamtportfolios. Prognoseabweichungen erreichen kritische Mengen. Wind und Solar werden nicht abgeregelt, wenn die Preise auf den Spotmärkten im Minusbereich liegen, und so kosten sie dann Geld anstatt welches einzubringen. Meldungen über erwartete Einspeisungen an den Bilanzkreiskoordinator (z. B. Übertragungsnetzbetreiber) haben enorme Deltas. Der Handel hinkt hinterher und wird mit teuren Ausgleichskosten für nachträgliche Portfoliokorrekturen bestraft. Warum dies geschieht? Weil es von Natur aus schwieriger ist, den Verlauf der PV- oder Windeinspeisung zu prognostizieren als die Baseload eines konventionellen Kraftwerks. Einerseits gibt es womöglich noch nicht eine ähnliche Menge historischer Daten, auf die man sich verlassen könnte. Andererseits weiß der Energieversorger in vielen Fällen nicht genau, was sein Portfolio aus erneuerbaren Energien im Moment eigentlich produziert.
Also wendet sich der Energieversorger der Technologie eines Virtuellen Kraftwerks zu, um die Dinge in den Griff zu bekommen: Alle erneuerbaren Energiequellen (EE) im Portfolio dieses Versorgers sind über Fernsteuereinheiten vernetzt, sodass das aggregierte Volumen der Stromerzeugung aus allen dezentralen Anlagen live angezeigt wird und alle oder einzelne PV- und Windparks vom zentralen Trading Floor aus abgeregelt werden können. Darüber hinaus werden historische Daten entweder durch Import von VNB-Messdaten in das System gespeist oder eine eigene Datenbank selbst aufgebaut, sobald alle Anlagen ihre Einspeisedaten übermitteln. Nun fügt man eine Prise meteorologische Prognosedaten zum Rezept hinzu und unterzieht den ganzen Teig einer statistischen Analyse und maschinellen Algorithmen, um die bestmögliche Prognose des gesamten erneuerbaren Portfolios zu erhalten. Woher das Geld dafür nehmen? Aus vier Quellen: Erstens spart der Portfoliomanager Ausgleichsenergiekosten, die auf vielen Energiemärkten weltweit anfallen, wenn die Prognosen des Portfolios eines Stromhändlers nicht mit der tatsächlichen Einspeisung übereinstimmen. Zweitens kann der Portfoliomanager oder der Händler das EE-Portfolio jetzt abregeln, sobald die Preise unter Null fallen. Drittens, falls das EE-Portfolio flexible Erneuerbare wie Bioenergie, Wasserkraft oder Geothermie enthält, kann der Händler das Virtuelle Kraftwerk nutzen, um den Fahrplan dieser Anlagen zu optimieren und zu steuern, z. B. durch Hochfahren der Stromproduktion, wenn die Strompreise voraussichtlich steigen. Auf diese Weise ist er nun in der Lage, die Durchschnittspreise auf den Kurzfristmärkten zu schlagen. Schlussendlich lernt der Händler durch ein besseres Verständnis des eigenen EE-Portfolios auch mehr über die gesamte Marktsituation und darüber, wohin sich die Spotmarktpreise entwickeln werden, da PV und Wind auf Energiemärkten mit höheren Anteilen an erneuerbaren Energien tendenziell zu den Preistreibern gehören. Diese Informationen nutzt der Stromhändler dann, um nicht nur eine sicherere, sondern auch eine potenziell lukrativere Handelsposition einzunehmen.
Überblick: VPP Business Case “Prognose, Handel, Optimierung & Abregelung Erneuerbarer Energien”
| Wer betreibt das VK? | Welche Technologien sind beteiligt? | Was liefert das VK? | Wo existiert dieser Business Case bereits? | Wie wird dadurch Geld gespart/verdient? |
| Unabhängige Stromversorger; Stadtwerke; Manager/Händler eines Portfolios mit hohem Anteil erneuerbarer Energien | PV, Wind, Bioenergie, Wasserkraft, andere dezentrale Energiequellen | Koordination der EE-Flotte; verbesserte Prognose und exakte Bestimmung der EE-Volumen; Abregelung der EE | Hauptsächlich Europa | Geringere Ausgleichsenergiekosten; keine Einspeisung mehr in Zeiten negativer Preisgestaltung; optimierter preisorientierter Dispatch von steuerbaren erneuerbaren Energien; insgesamt bessere Handelspositionen |
Aggregation der Netzflexibilität aus Erneuerbaren Energien
Beweisstück A zeigt, wie ein Virtuelles Kraftwerk beim Management eines EE-Portfolios aus der Sicht eines Händlers hilft. Aber was ist mit den tatsächlichen physischen Schwankungen, über die der Händler jetzt mehr und früher als zuvor Bescheid weiß, die aber natürlich trotzdem auftreten und die innerhalb des Netzes physisch ausgeglichen werden müssen? Zunächst einmal ermöglicht mehr Vorlaufzeit aufgrund verbesserter Prognosen bereits jetzt dem gesamten Markt - anderen Händlern und Dispatchern - schneller auf Schwankungen zu reagieren und damit gegenzusteuern, bevor diese Schwankungen im System Schaden verursachen können. Aber noch wichtiger ist, dass ein Aggregator Erneuerbare Energien nicht nur vernetzt, um deren Prognosen zu verbessern, sondern auch, um dem Netzbetreiber Systemdienstleistungen anbieten zu können. Nachdem das zentrale Steuerungssystem des VPP ein Signal zum Hoch- oder Herunterfahren der vernetzten Stromerzeuger vom Netzbetreiber erhalten hat, teilt es dieses Signal in Hunderte oder Tausende von Einzelsignalen für die einzelnen steuerbaren Anlagen auf - natürlich unter Berücksichtigung ihrer Beschränkungen hinsichtlich der Reaktionszeit, der Füllstände, der Wärmeerzeugung, um nur einige zu nennen. Dann sendet es automatisch den Befehl an die beteiligten vernetzten Anlagen und fährt sie hoch oder runter, um die Netzfrequenz zu unterstützen und genau die Schwankungen auszugleichen, die andere Anlagen im Virtuellen Kraftwerk - meist PV und Wind - überhaupt erst verursacht haben. Und wieder: Wie damit Geld verdienen? Da kurzfristige Reserven für den Betrieb des Stromsystems und für die Versorgungssicherheit, die wir alle täglich genießen, äußerst wichtig sind, haben sie einen erheblichen Preis. Die Erschließung dieses Potenzials durch die Bereitstellung kurzfristiger Reserven für den Netzbetreiber ist ein ausgezeichneter Business Case für Aggregatoren, insbesondere, weil sie nicht in den physischen Aufbau flexibler Stromerzeugung (z. B. Gaskraftwerke oder Pumpspeicherkraftwerke) investieren müssen, sondern lediglich in die Vernetzung bestehender kleinerer flexibler Anlagen. Traditionell teilt der Betreiber des Virtuellen Kraftwerks die Einnahmen aus der Lieferung von Regelenergie oder anderen Systemdienstleistungen mit den Betreibern der im Virtuellen Kraftwerk vernetzten, steuerbaren EE-Einheit. In nicht liberalisierten Märkten, in denen es noch keine Ausschreibungen für diese Reserven gibt, kann der Übertragungsnetzbetreiber (ÜNB) selbst zum Aggregator werden, um die Flexibilität der dezentralen Erzeuger zu nutzen.
Überblick: VPP Business Case “Aggregation der Netzflexibilität aus Erneuerbaren Energien“
| Wer betreibt das VK? | Welche Technologien sind beteiligt? | Was liefert das VK? | Wo existiert dieser Business Case bereits? | Wie wird dadurch Geld gespart/verdient? |
| Unabhängige Aggregatoren, Stromversorger, Übertragungsnetzbetreiber | Bioenergie, Wasserkraft, Erdgas- KWK, Geothermie | Flexibilität durch steuerbare dezentrale Energie-Anlagen | Europa, Nordamerika, Ostasien, Australien | Zusatzeinnahmen durch die Teilnahme am Regelenergiemarkt/an Märkten für Systemdienstleistungen |
Demand Response Aggregator
Im Grunde genommen eine Teilmenge von Beweisstück B: Ein Aggregator kann sich nicht nur für die Aggregation von Stromerzeugungseinheiten entscheiden, sondern auch (oder ausschließlich) für Einheiten auf der Nachfrageseite (sogenanntes Demand Response Management), um Systemdienstleistungen für das Netz bereitzustellen. Dem Stromnetz ist es egal, ob man die Stromerzeugung eines Wasserkraftwerks hochfährt oder ob man den Stromverbrauch, z. B. einer Klimaanlage oder des Kühlsystems eines Lagerhauses, herunterfährt. Der Effekt auf die Netzfrequenz ist derselbe, sodass es auch einen Business Case für Aggregatoren (der Begriff "Virtuelles Kraftwerk" scheint hier nicht zutreffend zu sein) auf Verbrauchsseite gibt. In einigen Energiemärkten gibt es sogar zusätzlich zu den Märkten für Systemdienstleistungen spezielle Ausschreibungsverfahren für Reserven, die durch Demand Response bereitgestellt werden, um deren Entwicklung zu fördern – in Deutschland etwa die Verordnung zu abschaltbaren Lasten. Zwar ist die Aggregation von Demand Response heute noch ein sehr regionales Phänomen (USA, Australien) und oft auf gewerbliche und industrielle Stromverbraucher beschränkt, jedoch birgt sie ein gigantisches Potenzial, sobald winzige Flexibilitäten auf Haushaltsebene (z. B. Elektroautobatterien, Heizungspumpen, Klimaanlagen) aggregiert und auf dem Energiemarkt aktiv werden.
Darüber hinaus kann eine Flotte aggregierter Demand-Response-Einheiten nicht nur für die Bereitstellung von Systemdienstleistungen für die ÜNB, sondern auch für die Steuerung des Verbrauchs der vernetzten Einheiten in Zeiten niedriger Preise auf den Spotmärkten eingesetzt werden - auf diese Weise können die Kosten für die Strombeschaffung für jede Anlage gesenkt werden.
Überblick: VPP Business Case “Demand Response Aggregator”
| Wer betreibt das VK? | Welche Technologien sind beteiligt? | Was liefert das VK? | Wo existiert dieser Business Case bereits? | Wie wird dadurch Geld gespart/verdient? |
| Unabhängige Aggregatoren; Stromversorger; ÜNB | Elektrische Heizung, elektrische Kühlung, Pumpen, Elektrolyse, Pyrolyse, Kompressoren, Batterien | Flexibilität durch flexible Stromkonsumenten | Nordamerika, Australien, Europa | Einnahmen durch Ausschreibungen von Systemdienstleistungen |
Ein paar Gedanken zum Schluss
Wie jede Typologie hat auch diese ihre Schwächen. Die Grenzen zwischen den verschiedenen Business Cases sind natürlich fließend: je nach Struktur und Regulierung des Energiemarktes, auf dem der Aggregator tätig ist, aber auch abhängig von den aktuellen und sich ständig ändernden Preissignalen auf diesen Märkten. Man kann sich auch leicht Aggregatoren vorstellen - und finden -, die alle drei Business Cases in einem Virtuellen Kraftwerk kombinieren. Aber eines ist sicher: Die groß angelegte Integration erneuerbarer Energien in Netze und Märkte erfordert ein systematisches und gut koordiniertes Vorgehen durch Virtuelle Kraftwerke - und damit lässt sich Geld verdienen.
- Photo Credit: Andrés Moreira, License: CC BY-SA 2.0
Weitere Informationen und Dienstleistungen