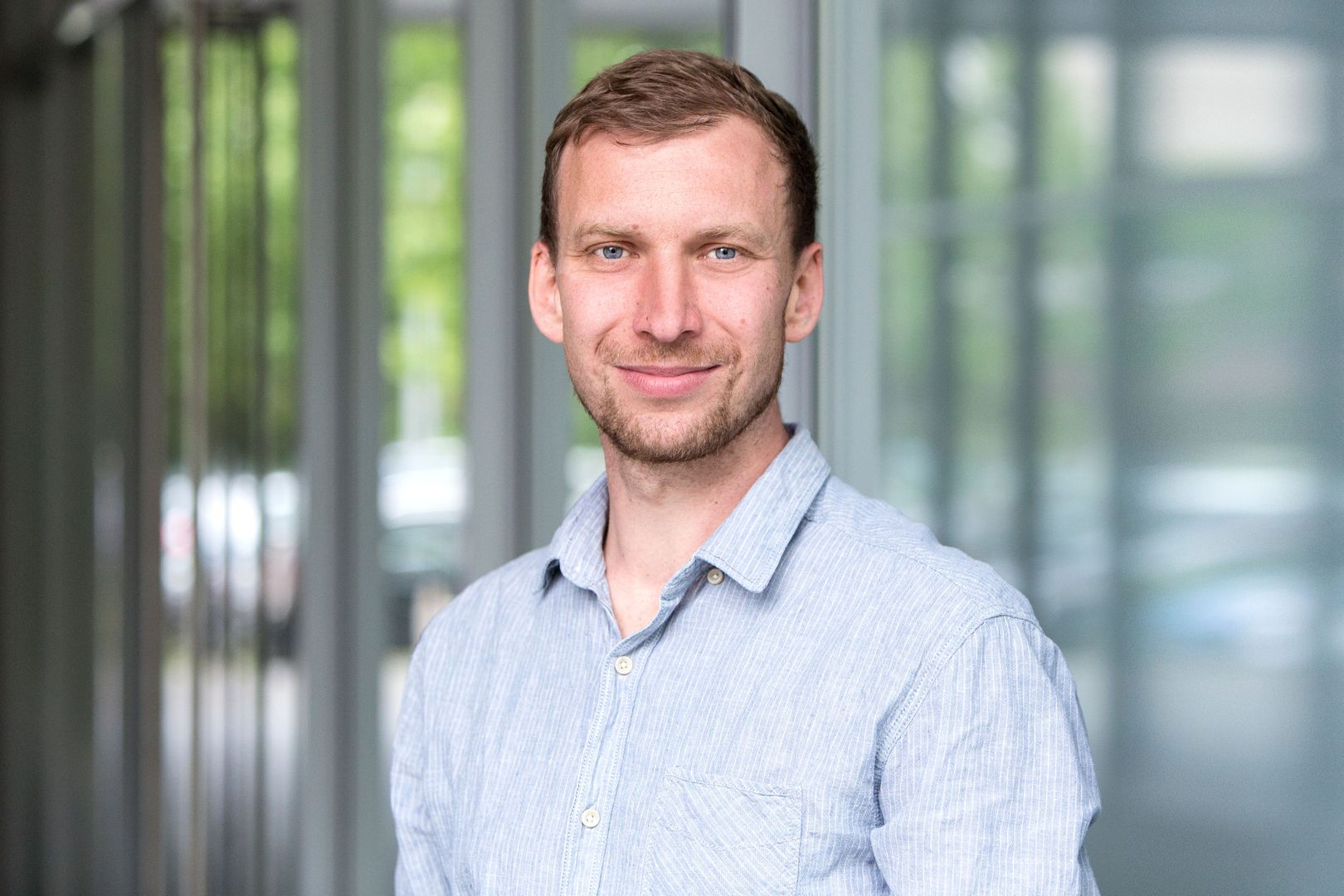Für eine Erweiterung des Speicherbegriffs
Löst man sich vom konventionellen Batteriespeicherbegriff, findet man in der Industrie vielfältige Speicherformen, die dafür geeignet sind, den Stromverbrauch zu flexibilisieren.

Im Zusammenhang mit der Energiewende gewinnt der Begriff der Flexibilität zunehmend an Bedeutung. Dahinter verbirgt sich die Notwendigkeit Stromverbrauch und Stromerzeugung zeitlich zu variabilisieren und so der Dargebotsabhängigkeit der erneuerbaren Energien anzupassen.
Kurzum bedeutet dies nichts anderes als diese Prozesse kurzfristig steuerbar zu machen. Denn die Fristigkeit in der Energiewirtschaft hat sich in den letzten Jahren bereits drastisch verkürzt und es ist davon auszugehen, dass dieser Trend auch in den nächsten Jahren anhalten wird.
Unter diesem Gesichtspunkt stellt sich Flexibilität als die Anforderung für moderne Unternehmen dar, wobei Speicher hingegen das Instrument zur Schaffung dieser Flexibilität sind. Grundsätzlich wird durch einen Speicher die Möglichkeit geschaffen Erzeugung und Verbrauch zeitlich voneinander zu entkoppeln. Löst man sich in dieser Beziehung von dem konventionellen Batteriespeicherbegriff, findet man insbesondere in der Industrie vielfältige Speicherformen, die dafür geeignet sind, den Stromverbrauch zu flexibilisieren. Als Speicherformen kommen in Frage:
- Stoffliche Speicher wie beispielsweise Zwischenspeicher innerhalb einer Wertschöpfungskette (Silos, Gasspeicher etc.).
- Kapazitive Speicher, die dadurch entstehen, dass die Produktion nicht auf Volllast fährt. Die Produktion kann dadurch variabel hoch- bzw. runterfahren.
- Inhärente Speicher bei Wärme- beziehungsweise Kälteprozessen sowie die Nutzung von Temperaturtoleranzbändern.
- Eigenerzeugungsanlagen (Notstromaggregate etc.), die je nach Betriebskonzept im Zusammenspiel mit der sonstigen Stromversorgung des Unternehmens als intrinsische Speicher angesehen werden können.
- KWK-Anlagen, deren Wärmespeicher Flexibilität schaffen.
Aus den genannten Speicherformen lassen sich unterschiedliche Vermarktungskonzepte realisieren. Die Schwankungen in der Stromerzeugung bedeuten, dass die Flexibilität auf Verbraucherseite zu einem wirtschaftlichen Faktor wird, mit dem sich zusätzliche Erlöse erzielen lassen. Denn durch eine Flexibilisierung der Stromabnahme kann sich ein Unternehmen die Volatilität des Strommarktes zunutze machen. Die Möglichkeiten, Flexibilität nutzbar zu machen, sind vielfältig und können allgemein in zwei Blöcke differenziert werden:
- Die Strombezugskosten lassen sich signifikant senken, indem der Strombezug in Zeiten niedriger Strompreise gelegt wird (Ausnutzung der Preisvolatilität a) untertägig, b) stündlich und c) viertelstündlich).
- Durch die Bereitstellung von Systemdienstleistungen können Mehrerlöse generiert werden (Regelenergie in der Minutenreserve und der Sekundärreserve).
Eine Anbindung an ein virtuelles Kraftwerk ermöglicht diese Potenziale viertelstundengenau ausschöpfen. Das oberste Kriterium bei der Bewertung von Speicherpotentialen von industriellen Stromverbrauchern muss nichtsdestotrotz die Einhaltung des originären Produktionsfahrplans und -aufkommens sein. Die Nutzung von Flexibilität stellt lediglich einen wirtschaftlichen Mehrwert beziehungsweise eine wirtschaftliche Optimierung dar. Die leittechnische Anbindung von Industriestandorten an ein virtuelles Kraftwerk ist in diesem Zusammenhang kein Muss, sie ist letztlich abhängig von dem gewählten Vermarktungskonzept.
Das in der Industrie gelebte Sakrament der autonomen Prozesssteuerung sollte dennoch relativiert werden: Flexibilität bedeutet schnelles reaktives Handeln auf Marktsignale. Je schneller Lasten gesteuert werden können, desto besser sind die Vermarktungsoptionen. Eine externe Steuerung durch ein virtuelles Kraftwerk macht demnach in bestimmten Fällen Sinn, wohlgemerkt unter Einhaltung der betrieblichen Restriktionen.
Mehr zum Nachlesen
Es gilt die beschriebenen Speicherpotentiale zu identifizieren und nutzbar zu machen. Die Betreiber virtueller Kraftwerke bieten Industriestandorten dabei das notwendige Markt-Know How sowie die Kompetenz für den Zugang in die beschriebenen Flexibilitätsmärkte.
- Dieser Beitrag ist erstmalig im Blog des Pilotprojekts Demand Side Management Bayern der dena am 11.5.2015 erschienen.
- Das Projekt DSM Bayern bringt Unternehmen, Wissenschaft, Politik, Flexibilitätsvermarkter und diverse andere an einen Tisch und bietet damit eine ideale Plattform zur Marktintegration der Lastseite.
- Fotocredit: Eric Borja, Lizenz: CC BY 2.0
- nachträglich bearbeitet am: 04.10.2016, Christian Sperling
Weitere Informationen und Dienstleistungen